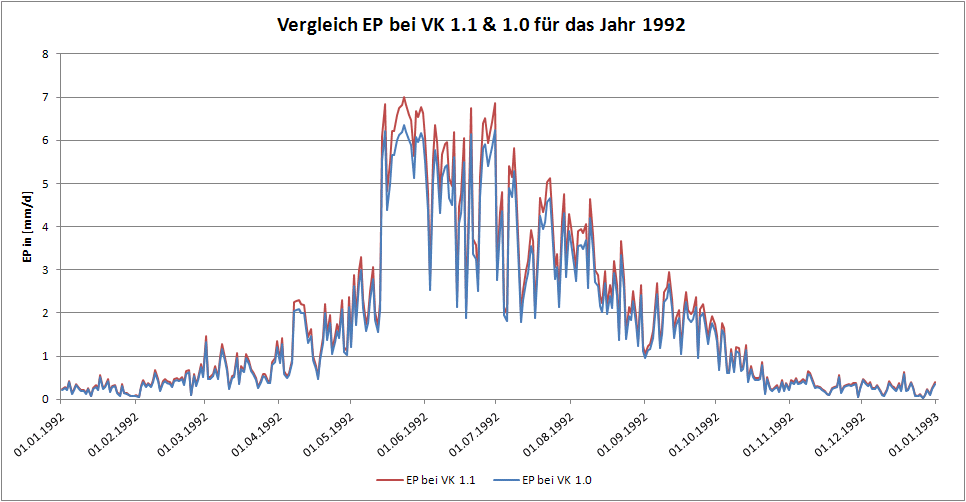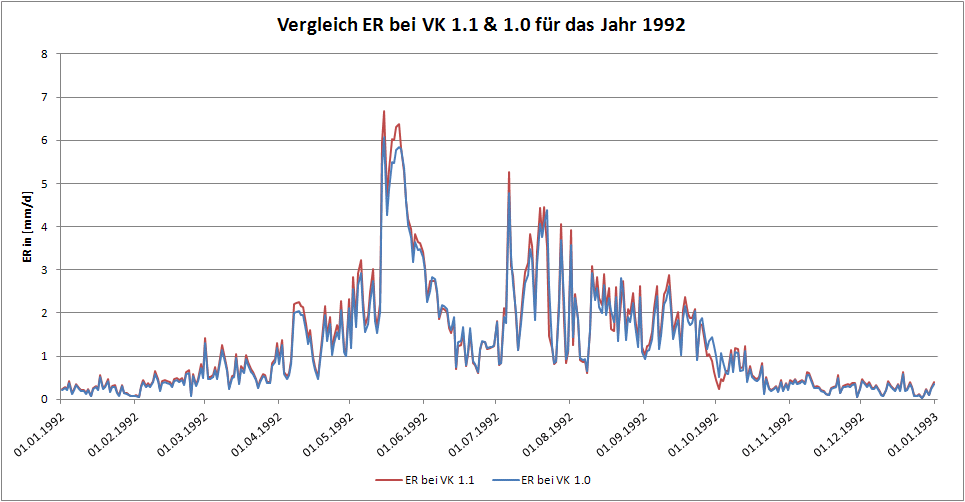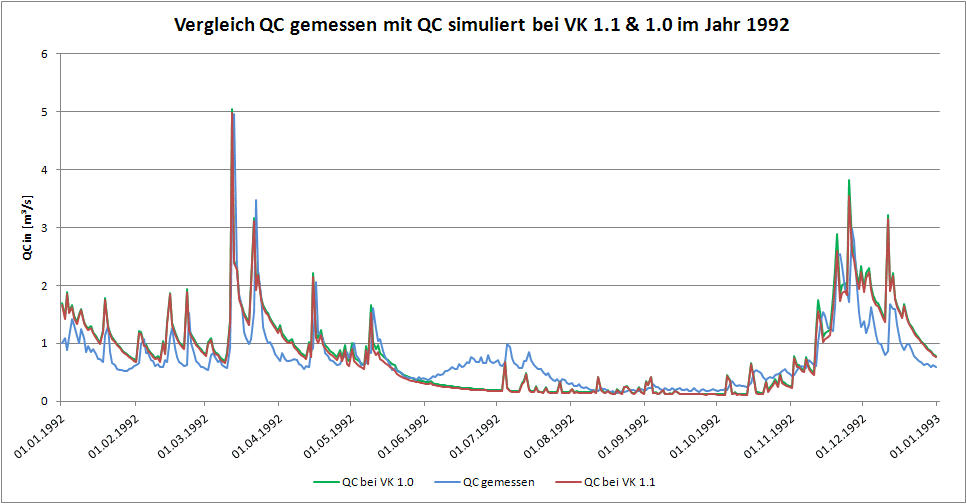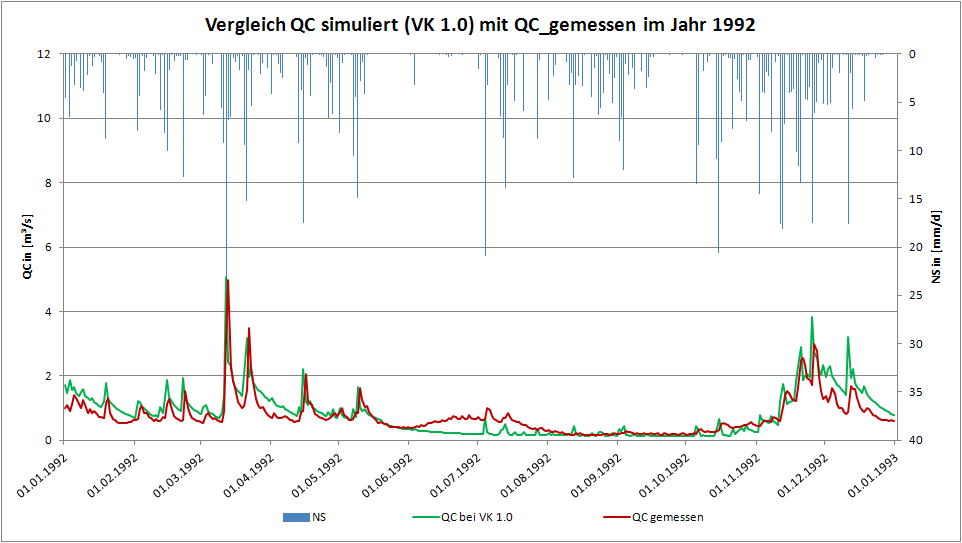3.2 Übung 2: Verdunstungskorrektur
Die Verdunstung ist neben dem Niederschlag die einflussreichste Größe auf den Wasserhaushalt und somit auf die Abflussprozesse. Inwiefern sich der Abfluss aufgrund veränderter Verdunstungsverhältnisse verändert, soll diese Übung verdeutlichen.
Ändern Sie in der modul.ste die Verdunstungskorrektur von 1.1 auf 1.0. Denken Sie daran in der arc_egmo.ste die Berechnungsvariante umzubenennen (z.B. in Verdunstungskorrektur 1.0), damit ein neuer Ordner für die Ergebnisse erstellt werden kann. Speichern Sie die modul.ste sowie arc_egmo.ste. Führen Sie die Rechnung wie in Übung 1 durch. Die Ergebnisse sollten in Excel nach verschiedenen Kriterien, mit Hilfe von Diagrammen ausgewertet und verglichen werden:
a) Vergleichen Sie die Ergebnisse des Basisszenarios mit den neuen Ergebnissen.
b) Inwiefern hat eine Verringerung der Verdunstungskorrektur um 10% Einfluss auf die Wasserhaushaltsgrößen?
c) Vergleichen Sie die berechneten Abflüsse mit den gemessenen.
Nachdem Sie mit der Bearbeitung dieser Aufgabe fertig sind, stellen Sie das Basisszenario wieder her.
Verdunstungskorrektur ist ein Faktor zur Korrektur der berechneten bzw. gegebenen potenziellen Verdunstung
- Verdunstkorr_1.1 entspricht dem Basisszenario
- Verdunstkorr_1.0 entspricht der Aufgabe
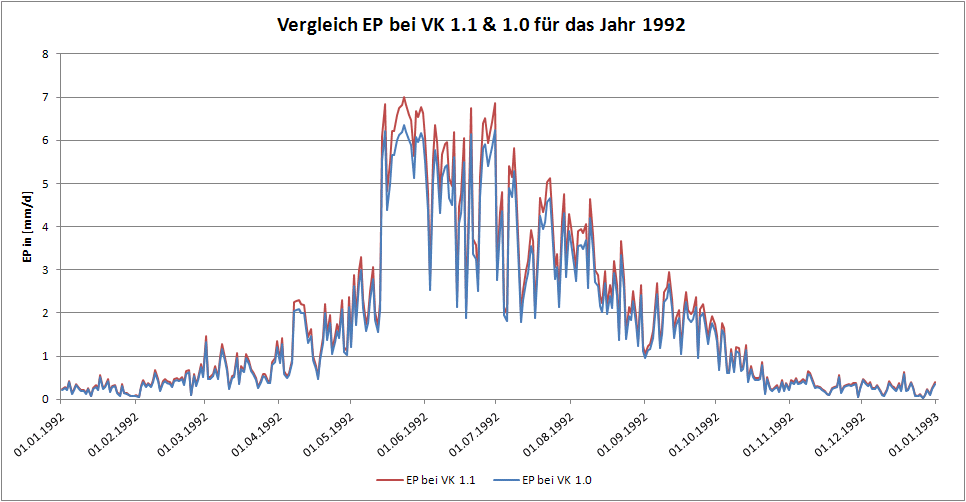
Abbildung 2‑1: Darstellung der potenziellen Verdunstung bei unterschiedlichen Verdunstungskorrekturen
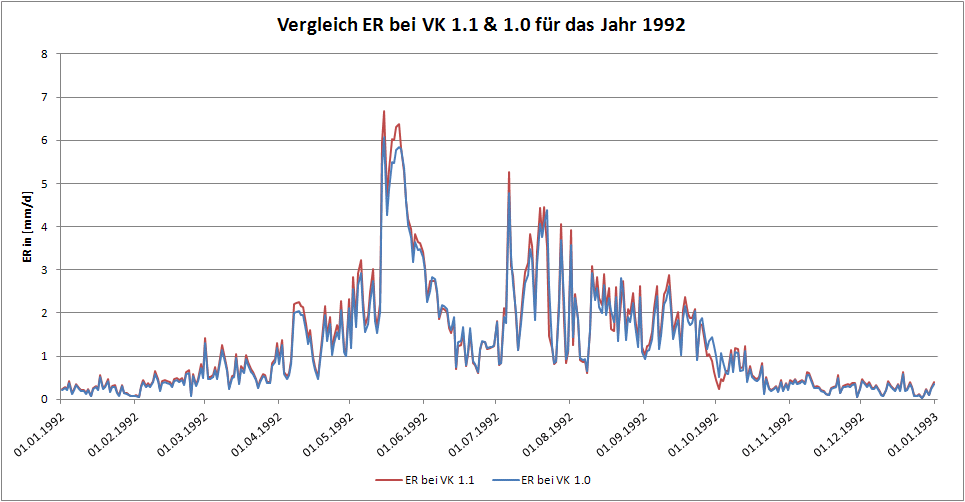
Abbildung 2‑2: Darstellung der realen Verdunstung bei unterschiedlichen Verdunstungskorrekturen
Beobachtung:
- Die ER und die EP mit unterschiedlichen VK's zeigen geringe Unterschiede in deren Verlauf für das Jahr 1992
- ER und EP, simuliert mit einem VK 1.1, liegen höher als die Simulation von ER und EP mit einem VK von 1.0
- der größte Unterschied zeigt sich in den Sommermonaten, von Mitte Mai bis Anfang Oktober
- die Abweichung bei ER ist allerdings geringer als die Abweichungen bei EP
- Allerdings befindet sich ER mit VK 1.1 simuliert, im Oktober der Jahres 1992 unterhalb des ER mit VK 1.0
- Die anderen Wasserhaushaltsgrößen wie RO und GWN steigen gering an
Erklärung:
- Die Begründung liegt in der Bedeutung des VK's
- Er ist zur Korrektur der potenziellen Verdunstung in der Simulation eingebaut
- Wird dieser nun verändert, zeigen sich größere Unterschiede bei EP als bei ER
- Die geringere Verdunstung bei höherer VK (VK=1.1) im Oktober ist darauf zurückzuführen, dass durch die zuvor durchweg höhere Verdunstung gegenüber der VK 1.0 am Ende des Sommers das Wasserangebot aufgebraucht ist
- Der Anstieg des RO und der GWN geht aus der geringen Verdunstung hervor. Wenn weniger Wasser verdunstet, steht mehr für die Versickerung und den Landoberflächenabfluss zur Verfügung
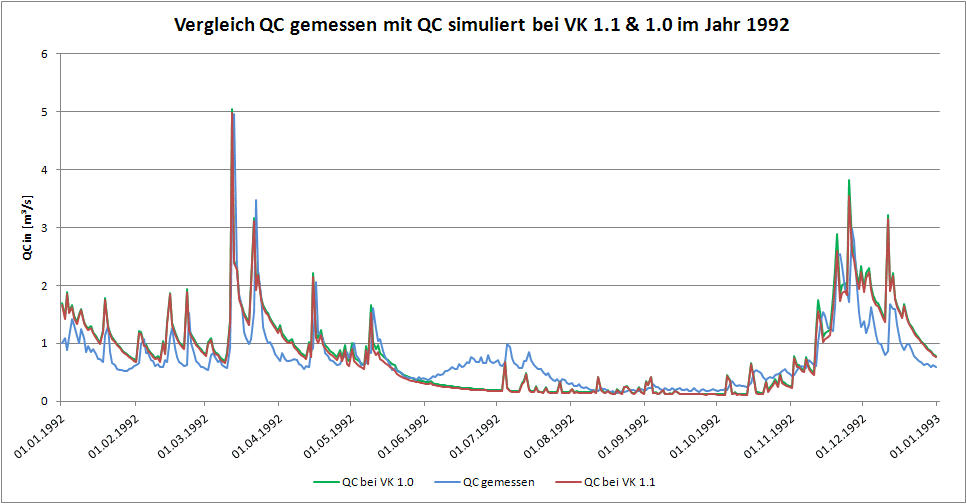
Abbildung 2‑3: Vergleich der Ganglinien des gemessenen Gesamtabflusses mit den simulierten
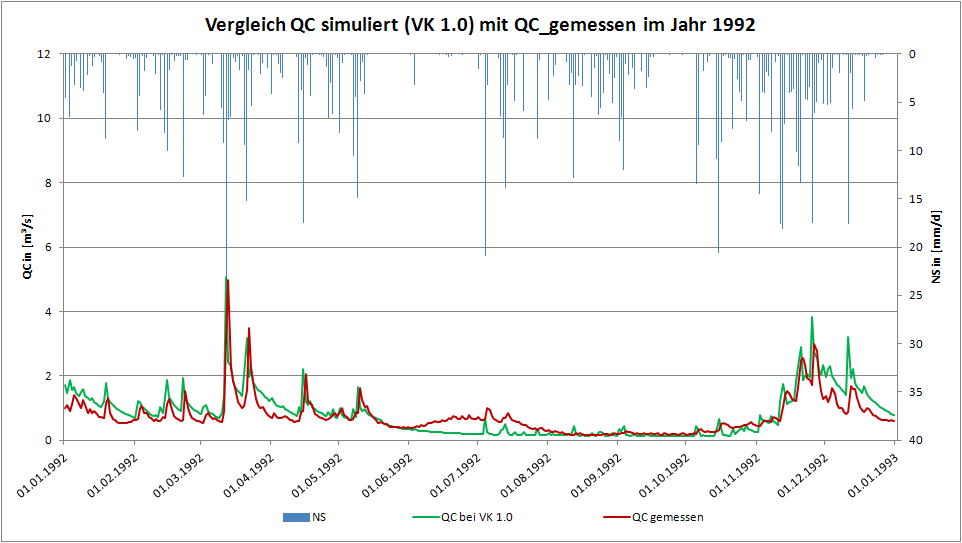
Abbildung 2‑4: Vergleich des simulierten Gesamtabflusses mit dem Gemessenen
Beobachtung:
- Der Unterschied zwischen den Ganglinien mit unterschiedlichen Verdunstungskorrekturen ist gering (siehe Abbildung 2‑3). Die Ganglinie des QC mit VK 1.0 ist in den Abflussspitzen höher
- Verdunstungskorrektur nimmt also kaum Einfluss auf QC
- Die simulierte QC‑Ganglinie mit VK 1.0 zeigt im Vergleich mit der gemessen QC‑Ganglinie größtenteils gute Übereinstimmung
- Die Ganglinie des simulierten QC überschreitet die des gemessenen QC allerdings um 0,1 bis 1,5 m³/s
- Die größten Abweichungen betreffen die Zeit von Juni bis September sowie den Dezember
- QC gemessen ist mäßig hoch, dagegen ist die simulierte Ganglinie für diese Monate sehr gering
Erklärung:
- Zwar ist in den Sommermonaten das NS‑Angebot sehr hoch, allerdings verdunstet der größte Anteil
- das Wasser kann weder abfließen, noch in den Boden infiltrieren ⇒ somit ist der geringe simulierte QC in diesen Monaten plausibel
- Die gemessenen Anstiege des RO im Juli sind nach der langen Trockenperiode ab Mitte Mai (fast kein NS) nicht plausibel
- eventuell handelt es sich hierbei um eine Reaktion des Gebietes auf ein lokales Neiderschlagsereignis, das in den Niederschlagsstationen nicht aufgezeichnet wurde