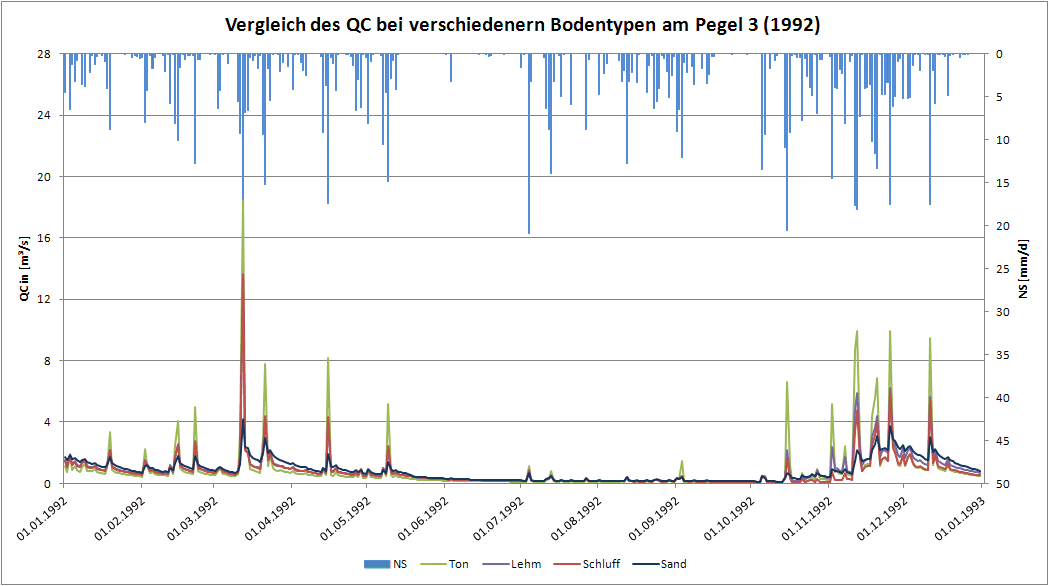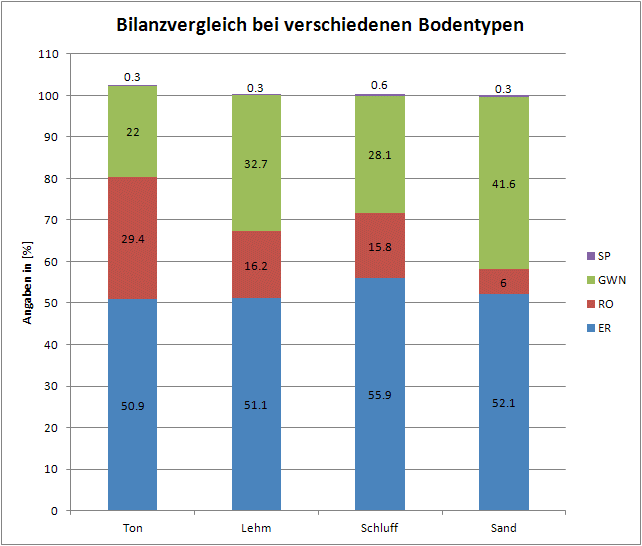3.10 Übung 10: Bodenarten
Eine Änderung der Bodenart hat großen Einfluss auf den Wasserhaushalt. Sie beeinflusst Verdunstung, Infiltration, Grundwasserneubildung und letztlich auch den Abfluss.
Um dies zu untersuchen öffnen Sie die boden.tab (zu finden unter D:\NA-Modell_ArcEGMO\GIS\Ascii.rel) mit Excel. Fügen Sie neben der Spalte Boart vier neue ein. Benennen Sie diese nach den Bodenarten die Sie testen wollen (z.B. Bo_Sand, Bo_Schluff, Bo_Ton und Bo_Lehm). Füllen Sie die Spalten mit der entsprechenden Abkürzung für die jeweilige Bodenart (für die Rechnung wird angenommen, dass das Gebiet nur eine einzige Bodenart besitzt. Daher die gesamte Spalte mit nur einer Bodenart versehen):
- Ss = reiner Sand
- Uu = reiner Schluff
- Tt = reiner Ton
- Lts = sandig-toniger Lehm
Speichern Sie die Datei im txt-Format, aber behalten Sie den Dateinamen "boden.tab" bei (boden.tab). Öffnen Sie die efl.sdf. Unter "Relate-Tabellen" müssen Sie für jede Rechnung bei Bodenart den Namen der entsprechenden Spalte der neuen Bodenart (den Namen des oben genannten Beispiels) eintragen. Speichern Sie die Datei. Ändern Sie für jede Rechnung in der arc_egmo.ste den Namen der Berechnungsvariante und speichern Sie diese Datei.
Interpretieren Sie die Abflussganglinien für die verschiedenen Bodenarten am Pegel 3 für das Jahr 1992. Tragen Sie am Ende in der efl.sdf für die Bodenart wieder den alten Namen boart ein. Speichern Sie die Datei.
- Eine Änderung der Bodenart hat großen Einfluss auf den Wasserhaushalt
- Sie beeinflusst Verdunstung, Infiltration, Grundwasserneubildung und letztlich auch den Abfluss
Tabelle 10-1: Verwendetes Bodenarten
| Bodenart |
Bennenung |
Symbol |
| Reiner Sand |
Bo_Sand |
Ss |
| Reiner Schluff |
Bo_Schluff |
Uu |
| Reiner Ton |
Bo_Ton |
Tt |
| Sandig‑toniger Lehm |
Bo_Lehm |
Lts |
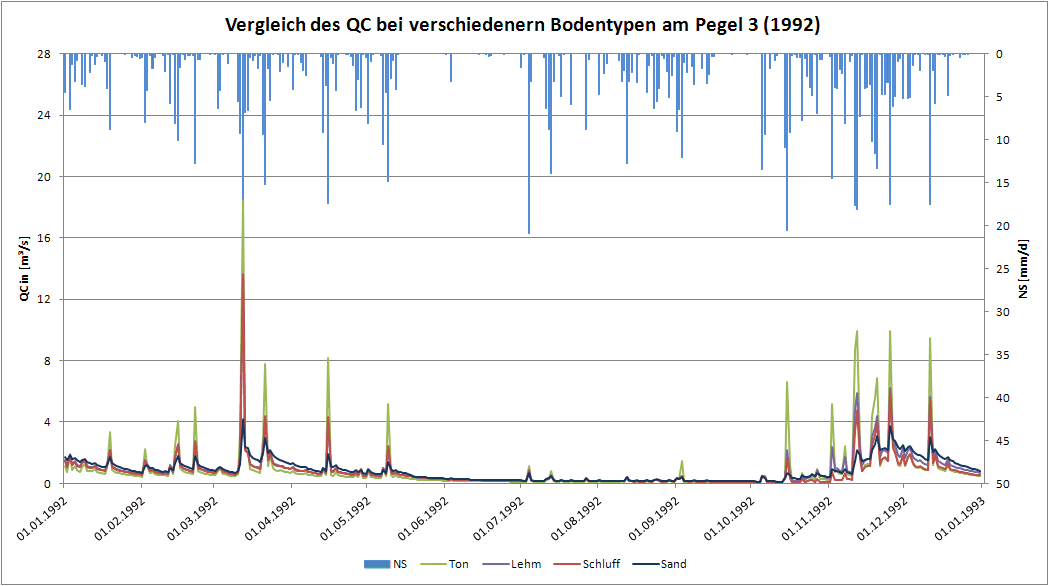
Abbildung 10‑1: Vergleich des Gesamtabflusses unterschiedlicher Bodenarten
Beobachtung:
- Die Abflussganglinie aus unterschiedlichen Bodensubstraten unterschieden sich voneinander
- Reiner Tonboden erzeugt die höchsten Abflussganglinien und die geringsten Trockenwetterabflüsse
- Aus reinem Sand werden die geringsten Abflussspitzen aber die höchsten Basisabflüsse modelliert
- Reiner Schluff und Sandig‑toniger Lehm befinden sich von den Komponenten im Mittelfeld zwischen reinem Ton und reinem Sand
Erklärung:
- Diese oben erläuterten Beobachtungen sind auf die Speichereigenschaften der unterschiedlichen Bodentypen zurückzuführen:
- Reiner Sand hat größere Hohlräume (Luftkapazität) zwischen den einzelnen Sandkörnern und hohe Durchlässigkeiten, wodurch das Wasser schnell im Boden transportiert wird, hohe Infiltration und Perkolation. Durch eine niedrigen permanenten Welkepunkt kann der Sand in Trockenwetterzeiten stark entwässert werden, hoher Basisabfluss
- Da der reine Ton feinere Komponenten hat als die anderen Bodenarten, kann das Wasser nicht schnell durch Ton fließen, geringe Durchlässigkeiten, geringer Bodenspeicher. Wenn die Speicherkapazität des Tones überschritten ist, kann das Wasser nicht mehr infiltrieren, sondern fließt schnell oberirdisch ab (RO), so dass hohe Abflussspitzen erzeugt werden (QC). Aufgrund des großen permanenten Welkepunktes halten reine Tonböden einen hohen Anteil des gespeicherten Wassers als Haftwasser, geringer Basisabfluss in Trockenzeiten
- Reiner Schluff und sandig‑toniger Lehm haben größere nutzbaren Feldkapazitäten als reiner Ton und reinem Sand, daher gute Speicherfähigkeit, Boden kann viel Wasser gegen die Schwerkraft halten, daher Bodenevaporation möglich aber auch Oberflächenabfluss bei Bodensättigung. Die Abflussganglinien des Schluffes und des sandig‑tonigen Lehm haben geringere Abflussspitzen als die des Tones, aber einen geringeren Basisabfluss als die aus sandigem Boden
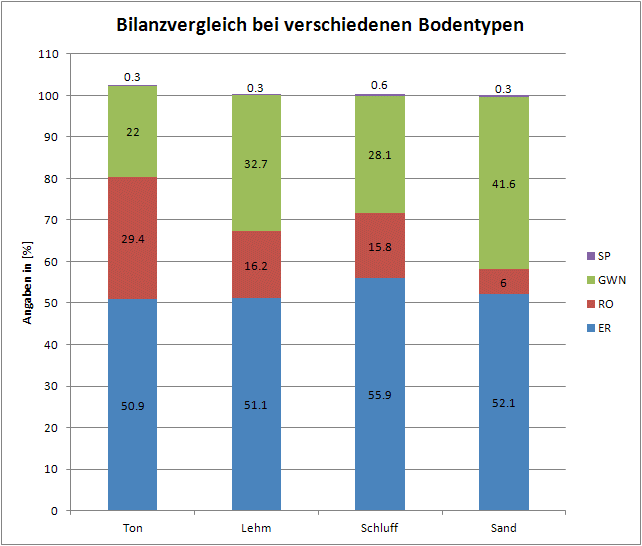
Abbildung 10‑2: Vergleich der Bilanzierungen der Modellebene ABI bei unterschiedlichen Bodenarten (1982-1993)
Beobachtung:
- Die Verdunstung von den Böden ist in etwa gleich (ca. 50‑56% des NS)
- Die Böden unterscheiden sich aber hinsichtlich der Aufteilung des restlichen NS Wassers in GWN und RO
- Die Speicheränderung SP ist für alle Nutzungen sehr gering und zeigt, dass über den modellierten Zeitraum keine großen Speicheränderungen auftreten
- bei reinem Sand können ca. 40% GWN bilanziert werden und RO ist mit etwas über 5% sehr gering
- bei reinem Schluff und sandig‑tonigem Lehm können nur noch 30% GWN bilanziert werden, aber RO ist mit 15% gegenüber Sand gestiegen
- bei reinem Ton kann kaum NS versickern und ein großer Teil des NS fließt oberirdisch ab (ca. 30% RO) und nur ein geringer Teil versickert (22% GWN)
Erklärung:
- auch im Vergleich der Wasserhaushaltsgrößen begründen sich die oberen Aussagen
- das NS‑Wasser fließt bei reinem Sand kaum oberirdisch ab, es kann gut und schnell infiltrieren, und wird kaum als Haftwasser im Boden gehalten, was dann wiederum die hohe GWN und den sehr geringen RO erklärt
- Schluffe und Lehmböden haben hohe nutzbare Feldkapazitäten und können daher viel Infiltrationswasser speichern, allerdings sind ihre Durchlässigkeiten geringer als Sand, so dass die Perkolation zum Grundwasser langsamer verläuft (geringerer Anteil an GWN). Ist der Bodenspeicher gefüllt erfolgt der Abfluss oberirdisch
- Der Ton hat geringere nutzbare Feldkapazitäten. Zusätzlich führen geringe Durchlässigkeiten zu einer sehr langsamen Bodenwasserbewegung, so dass der Bodenwasserspeicher wesentlich schneller gefüllt ist als bei gröberen Böden. Ist der Boden gesättigt kommt es zu Oberflächenabfluss, der den Abfluss im Vorfluter erhöht, der Ton kann kaum Wasser aufnehmen, wenn seine Quellfähigkeit ausgeschöpft ist, das meiste NS‑Wasser fließt oberirdisch ab und erhöht so QC mit